KI, Krisen & Kanzleien: Das war die Legal Innovation '25
KI & Datenschutz: Zwischen Möglichkeiten und Verantwortung
Die Keynote von Andreas Zavadil von der Datenschutzbehörde stellte eine zentrale Frage in den Raum: Wie nutzen wir KI-Systeme DSGVO-konform – ohne dabei Datenschutz zur Nebensache zu machen?
Datenschutz gibt es nicht erst seit der DSGVO, sondern seit den 1970er Jahren – doch die aktuellen Entwicklungen rund um generative KI, große Sprachmodelle und neue Rechenleistungen stellen alles bisher Dagewesene in den Schatten. Vor allem, wenn KI-Systeme mit personenbezogenen Daten arbeiten, wird es kritisch: Dann sprechen wir über Hochrisiko-Anwendungen, wie sie auch der AI Act klassifiziert. Diese sind zwar erlaubt, aber streng reguliert.
Zavadil betonte: Die DSGVO ist technologieneutral. Es ist also völlig unerheblich, ob ChatGPT oder ein anderes Tool im Einsatz ist – entscheidend ist der Kontext. Unternehmen müssen klar prüfen: Dürfen wir dieses Tool verwenden? Und für welchen Zweck?
Die richtige Governance, interne Schulung und ein ethischer Kompass sind essenziell. Denn KI kann halluzinieren, Daten können abfließen – und die Verantwortung bleibt beim Unternehmen. Ein wachsendes Feld – mit großer Verantwortung. Mehr dazu unter www.dsb.gv.at .
NIS 2 & Legal Tech: Wenn’s schiefgeht – und was man dagegen tun kann
Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie betrifft nicht nur klassische IT-Infrastrukturen – sondern ganz konkret auch Kanzleien, Rechtsabteilungen und Legal Tech-Anbieter. Wolfgang Raschka und Johann Schlaghuber (Siemens) betonten in ihrer Session die enorme Relevanz von Cybersecurity im juristischen Umfeld – und warum General Counsel und CISOs gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen.
In Zeiten geopolitischer Spannungen – von Russland über China bis hin zu Akteuren aus „befreundeten Staaten“ – steigt das Risiko gezielter Angriffe. Besonders gefährlich: veraltete Systeme, mangelnde Updates und fehlende interne Awareness. Die Folge können Datenabflüsse, Reputationsverluste oder sogar wirtschaftliche Schäden sein.
Klar ist: Cybersecurity darf nicht nur Sache der IT sein. Sie muss in der gesamten Organisation verankert sein – mit klaren Verantwortlichkeiten, Schulung und bereichsübergreifender Zusammenarbeit. Denn die Technik kann unterstützen – aber angegriffen werden am Ende die Menschen.
Besonders im Legal Tech-Bereich entstehen durch NIS 2 neue Anforderungen: Tools müssen sicher, nachvollziehbar und datenschutzkonform sein.
Fazit: Wer nicht vorbereitet ist, handelt fahrlässig. Wer jetzt handelt, verschafft sich einen echten Sicherheits- und Vertrauensvorsprung.
Espresso-Talks Tech and Legal
Einige Statements der Vortragenden:
• Werdet euch erst über euer Problem klar, bevor ihr nach Tools für die Lösungen sucht
• Was KI und Autos gemeinsam haben: Natürlich können Autos brennen oder explodieren das tun sie in (sehr) seltenen Fällen auch, deswegen will aber niemand zu Pferdefuhrwerken zurück.
• Letztlich nutzt es nichts, neue ausgeklügelte Systeme zu oktroyieren, wenn die Mitarbeiter eben weiter lieber mit Excel arbeiten.
• Ein gutes KI-gestütztes System sollte eine Brücke bieten zwischen User-Freundlichkeit und den für das Unternehmen erwünschten Zielen.
• Eine neue Software setzt sich dann durch, wenn es schnell zu Anfang gelingt, Erfolgsstories zu kreieren und zu kommunizieren.
• Es ist ein langer Weg, macht euch auf einen Marathon bereit (und zwar bergauf), nicht auf einen Sprint.
Value-Based Pricing: Warum es in der Kanzlei nicht um Stunden, sondern um echten Wert geht
In seinem Vortrag brachte der ehemalige Anwalt und Gründer von Big Yellow Penguin Shaun Jardine frischen Wind in die Diskussion über Kanzlei-Businessmodelle – mit britischem Humor, einem KI-Pinguin namens Declan und einer klaren Botschaft: „Es geht nicht um Zeit – es geht um Wert.“
Declan ist sein Chatbot – und Sinnbild für Veränderung. Veränderung, beginnt nicht mit einer E-Mail vom CEO, sondern mit dem Mut, Dinge anders zu denken. Value-Based Pricing bedeutet: Die Abrechnung basiert auf dem Nutzen für den Mandanten, nicht auf der investierten Zeit. Oder, wie Jardine sagt: „Du brauchst keinen Taschenrechner – du brauchst Mut.“
Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das: Bei einer Aufteilung von 70 zu 30 Kosten zu Deckungseitrag, gibt man auf eine 100-Euro-Gebühr 10 % Rabatt für die Mandanten, so verliert man, wenn die die Kosten gleich bleiben, selbst 33 % des Gewinns.
Mandanten wollen Lösungen, keine Rabatte. Und: Wert ist immer kontextabhängig. Wer für Evian das Zehnfache zahlt wie für Leitungswasser, zahlt nicht für das Durst löschen, sondern für Vertrauen, Marke und Leistungsversprechen.
Zur schon mit großer Vorfreude erwarteten Legal Innovation-Party ging es traditionell wieder in den Prater

Innovation im Recht: Zwischen Kultur, Komfortzone und kleinen Erfolgen
„Innovation beginnt dort, wo die Komfortzone endet“ – brachte es Marguerita Sedrati-Müller (Schönherr Rechtsanwälte) auf den Punkt. Für den Rechtsbereich bedeutet Innovation nicht, neue Produkte wie in der Industrie zu schaffen, sondern neue Lösungen für Mandanten und interne Stakeholder zu entwickeln.
Doch ohne die passende Unternehmenskultur bleibt jede Legal-Tech-Initiative bloße Fassade. Unternehmens-Kultur ist nicht das, was auf der Website als Mission-Statement steht – sondern das, was in der Kaffeepause geredet wird. „Culture eats strategy for breakfast“, dass Ztat kennt man, aber was heißt das im Kontext von Legal Inmnovation: Echte Veränderung gelingt nur, wenn Vertrauen und Fehlerkultur mitgedacht werden – gerade auch in im rechtlichen Bereich, in dem Fehler sehr teuer sein können.
Ihr Praxisbeispiel zeigt: Man braucht nicht sofort ein ganzes Team, manchmal reicht eine einzige engagierte Person mit Rückhalt aus der Führungsebene. Mit dem Aufkommen von KI rückte diese Rolle plötzlich ins Zentrum. Entscheidend ist das „Warum“ hinter jeder Initiative – und die Bereitschaft, interdisziplinär zu denken. Innovation ist Teamarbeit.
Ihr Fazit: Technik soll das Mühsame übernehmen – damit Zeit bleibt für Strategie, Kreativität und Beziehungspflege.
Konzernweite KI-Einführung: Erfahrungen von ALPLA
Christian Sparl berichtete davon wie in den ALPLA Werken ein KI-Systems in 46 Ländern global eingeführt und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Ziel des Projekts war es, die Rechtsabteilung zu entlasten und Risiken in Verträgen besser einschätzen zu können.
Das KI-System hilft, Standardfälle von komplexen Sonderfällen zu unterscheiden. So wurde deutlich, dass nicht jede Anfrage die Einschaltung einer Anwältin oder eines Anwalts erfordert. Zur Unterstützung führte Sparls Team eine Prompting-Datenbank ein und entwickelte ein intelligentes "Risk-Pilot"-Tool zur Risikobewertung von Verträgen. Durch Legal-Translation-Technologien und Automatisierung konnten die Abläufe zudem erheblich beschleunigt werden.
Eine besondere Herausforderung war das Erwartungsmanagement gegenüber den internen Stakeholdern aus Bereichen wie Risikomanagement, IT, Vertrieb, Compliance und Controlling. Wichtig war, die richtigen Erwartungen zu setzen: Die KI kann Entscheidungsprozesse vereinfachen, ersetzt aber keine juristische Expertise.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor war das richtige Projektteam. Gefragt mitzutun, wurden diejenigen, die offen für neue Ansätze sind – nicht solche, die „immer schon alles in Word gemacht haben“. Dieser offene Ansatz ermöglichte es, die KI-Lösung erfolgreich in der Unternehmenspraxis zu verankern. Der Erfahrungsbericht zeigt, dass mit dem passenden Team und klarem Erwartungsmanagement KI-Systeme die Arbeitslast im Rechtsbereich deutlich verringern und Prozesse beschleunigen können.
Juristische Arbeit im Wandel: Zwischen KI, Kanzleikultur und klarem Mehrwert
Im Abschlussgespräch diskutierten Katharina Bisset (Nerds of Law) und Armenak Utudjian (Präsident des ÖRAK) über die Zukunft der Anwaltschaft in einer zunehmend technologiegetriebenen Rechtswelt.
Der Tenor: KI wird die anwaltliche Arbeit nicht ersetzen, sondern unterstützen. Automatisierung soll den Arbeitsalltag entlasten – etwa bei lästigen Aufgaben wie Dokumentenablage oder Standardfragen, die heute oft schon „Dr. Google“ übernimmt. Gerade deshalb gilt es, den eigenen Mehrwert als juristische Fachkraft sichtbar zu machen: Analyse, Strategie, Urteilskraft – das sind keine KI-Funktionen.
Kritisch beleuchtet wurde auch die Rolle der europäischen Regulierung, etwa im Zusammenhang mit dem AI Act. Der Beratungsmarkt wächst, aber mit ihm auch die Anforderungen – vor allem an kleinere Kanzleien, die nicht über die Ressourcen großer Sozietäten verfügen.
Der Appell an die Legal-Tech-Community: Innovation muss inklusiv gedacht werden, nicht elitär. Der Zugang zu digitalen Tools darf nicht von Kanzleigröße abhängen. Und: Der Anwaltsberuf bleibt relevant – wenn er offen bleibt für Veränderung, für echte Beratung und für neue Wege.
Fazit: „Anwalt bleibt ein großartiger Beruf – gerade jetzt.“
Abschließend dankte Moritz Mirascija noch der Community, wir glauben an das Format und die Vienna Legal Innovation wird im April 26 wieder stattfinden, vielleicht auch wieder mit einem erneut um 10% gewachsenen Publikum.

















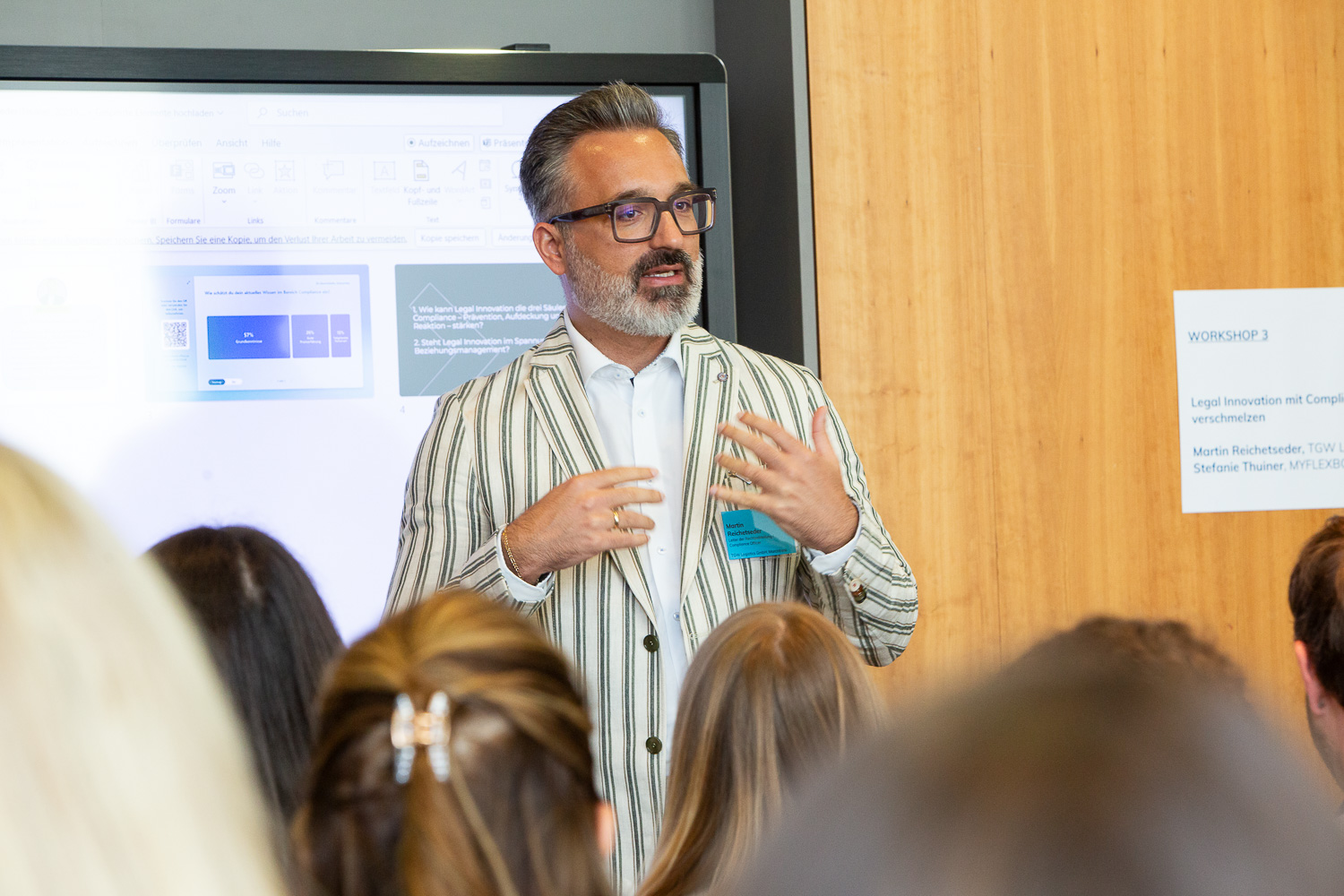













%20-%20Kopie.jpg)
.png)


